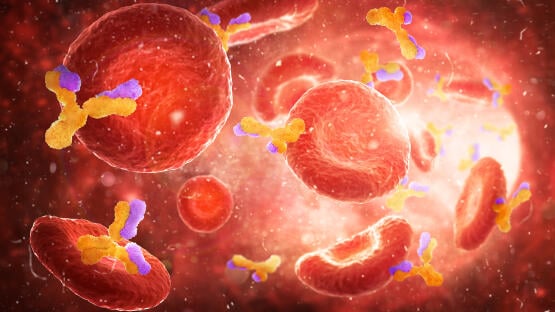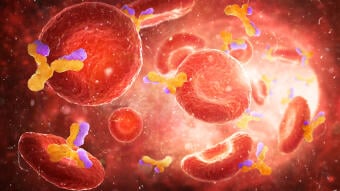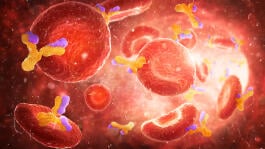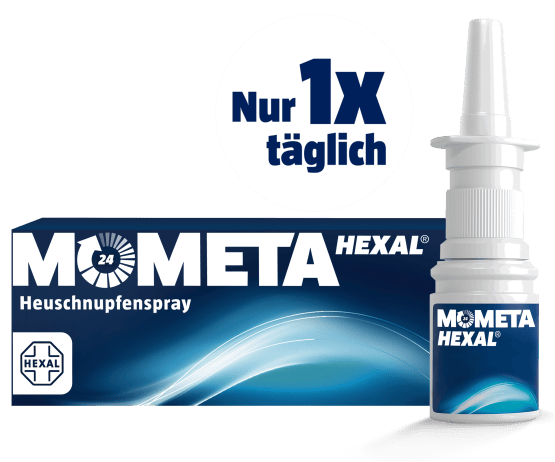Mittel gegen Allergie
Die wichtigste Basismaßnahme bei Allergien ist die sogenannte Allergenkarenz: Der Kontakt zu den Allergieauslösern sollte vermieden werden. Häufig gelingt es jedoch nicht, den Allergieauslösern ganz aus dem Weg zu gehen und Beschwerden zu vermeiden. Dann sind antiallergisch wirksame Medikamente gefragt. Erfahren Sie hier mehr über Wirkstoffe, Darreichungsformen und Anwendung.
Allergie-Medikamente
Antihistaminika-Tabletten, Heuschnupfensprays, Augentropfen oder Salben – zur Behandlung von allergischen Beschwerden stehen verschiedene Wirkstoffe und Darreichungsformen zur Verfügung. Diese unterscheiden sich z. B. im Hinblick auf Wirkweise, Wirkeintritt und Wirkdauer.
Wirkstoffe und Darreichungsformen
Zu den wichtigsten Wirkstoffgruppen, die bei allergischen Symptomen zum Einsatz kommen, zählen Antihistaminika und kortisonhaltige Medikamente.
Antihistaminika: Die schnelle Wirksamkeit der modernen Antihistaminika ist ein wichtiger Vorteil, wenn es darum geht, allergische Symptome rasch zu lindern. Bei Allergien wie Heuschnupfen, Hausstaub- oder Tierhaarallergie werden sie in der Regel in Tablettenform eingenommen. Darüber hinaus gibt es auch Augentropfen, Nasensprays oder Salben auf Basis von Antihistaminika
Glukokortikoide: Kortisonhaltige Medikamente werden wegen ihrer starken antiallergischen und antientzündlichen Wirkung sehr geschätzt. Bei allergischem Schnupfen können kortisonhaltige Nasensprays infrage kommen, die zwischenzeitlich ebenfalls rezeptfrei erhältlich sind. Bei schweren allergischen Reaktionen können Kortison-Tabletten erforderlich sein, die vom Arzt verordnet werden.
Darüber hinaus stehen verschiedene weitere Wirkstoffe zur Verfügung, die allerdings eher in Einzelfällen angewendet werden. So können – nach Rücksprache mit dem Arzt – insbesondere bei Kindern und Schwangeren sogenannte Mastzellstabilisatoren (Cromone) als Alternative zu Antihistaminika infrage kommen. Sie zeichnen sich durch eine gute Verträglichkeit aus, wirken allerdings nicht so gut wie Antihistaminika: Sie müssen vorbeugend (prophylaktisch) und mehrmals täglich angewendet werden – gegen bereits bestehende Symptome helfen sie nicht.
Gut zu wissen: Menschen, die zu starken allergischen Reaktionen neigen (z. B. bei Insektengiftallergie), sollten immer ein Notfall-Set mit sich führen. Dieses wird vom Arzt verordnet und enthält neben einem schnell wirksamen Antihistaminikum und einem Kortison-Präparat (Tablette oder Zäpfchen) auch eine Fertigspritze mit Adrenalin, die sich Betroffene selbst in den Muskel verabreichen können.
Welche Wirkstoffe in welcher Dosierung und Darreichungsform im Einzelfall geeignet sind, sollte mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.
Allergiemittel richtig anwenden
Allergiemedikamente kommen besonders häufig bei allergischem Schnupfen, also z. B. bei Heuschnupfen oder einer Allergie gegen Hausstaub, Tierhaare und Schimmelpilze zum Einsatz. Damit Allergiemedikamente in diesem Fall richtig wirken können, sollten Sie bei der Anwendung einige Aspekte berücksichtigen:
Einnahme von Antihistaminika (Tabletten)
- Ältere Wirkstoffe wie etwa Cetirizin sollten vorzugsweise abends eingenommen werden, da sie müde machen können. Bei weiterentwickelten Wirkstoffen wie Desloratadin oder Levocetirizin ist dies in der Regel nicht erforderlich.
- Bei bestimmten Antihistaminika muss die Einnahme in einem gewissen zeitlichen Abstand zum Essen bzw. zu bestimmten Getränken erfolgen.
Anwendung von Nasensprays mit Kortison
- Aufgrund ihres Wirkmechanismus brauchen kortisonhaltige Nasensprays etwas mehr Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Daher sollten sie insbesondere bei starkem allergischem Schnupfen bereits einige Tage vor Beginn der Allergie-Saison angewendet werden. Falls nötig, kann zu Beginn der Behandlung zusätzlich auch ein Antihistaminikum eingenommen werden, um akute Symptome rasch zu lindern – so lässt sich die Zeit gut überbrücken, bis die Wirkung des Nasensprays voll einsetzt.
- Manche Präparate müssen zweimal täglich angewendet werden, bei anderen wiederum ist die einmal tägliche Anwendung ausreichend. Vor der Anwendung die Nase putzen und anschließend den Sprühkopf nicht auf die Nasenscheidewand, sondern auf die gegenüberliegende Seite (also Richtung Nasenflügel) richten.
Grundsätzlich gilt: Lesen Sie sorgfältig die Informationen in der Packungsbeilage. Verabreichen Sie Kindern keine Medikamente ohne Rücksprache mit dem Kinderarzt. Auch Schwangere und Stillende sollten vor der Anwendung von Arzneimitteln immer ärztlichen Rat einholen.
Autoren, medizinische Fachinformationen und Quellen
Jetzt einblenden
Stand: zuletzt aktualisiert am 07.10.25
Wissenschaftliche Standards:
Dieser Text entspricht den Standards und Vorgaben aus der ärztlichen Fachliteratur, folgt den einschlägigen medizinischen Leitlinien, Veröffentlichungen von Fachgesellschaften sowie aktuellen Studien und wurde von Fachjournalisten geprüft. Mehr zu unseren Qualitätssicherungsstandards
Autoren:
Tatiana Schmid, Chefredaktion Gesundheit und Ernährung
Tatiana Schmid ist Diplom-Oecotrophologin und eine profilierte Fachjournalistin für Gesundheit, Medizin und Ernährung mit über einem Jahrzehnt redaktioneller Erfahrung. Mehr zur Autorin Tatiana Schmid
Jennifer Hamatschek, Chefredaktion Medizin und Pharmazie
Jennifer Hamatschek hat Germanistik und Pharmazie an der LMU München studiert. Sie ist eine renommierte Fachjournalistin für Medizin und Gesundheit, die seit über 15 Jahren komplexe medizinische Inhalte zielgruppengerecht und evidenzbaisert aufbereitet. Mehr zur Autorin Jennifer HamatschekICD-Codes:
- T28.4: Allergie, nicht näher bezeichnet
- J30.1: Allergische Rhinopathie durch Pollen (Heuschnupfen)
- J30.4: Allergische Rhinopathie, nicht näher bezeichnet
- T78.1: Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert
- L56.4: Polymorphe Lichtdermatose
- L25.9: Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache
- L50.9: Urtikaria, nicht näher bezeichnet
ICD-Codes (International Classification of Diseases) sind weltweit anerkannte medizinische Verschlüsselungen für Diagnosen. Sie werden von Ärzt:innen verwendet, um Krankheiten und Gesundheitsstörungen eindeutig zu klassifizieren und finden sich beispielsweise in Arztbriefen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Abrechnungen mit Krankenkassen.
Quellen:
- Pschyrembel Online: Allergie (Abrufdatum 07.10.25)
- Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAKI) u. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ): S-3 Leitlinie Allergieprävention (Stand: November 2022) (Abrufdatum 07.10.25)
- Klimek et al.: ARIA-Leitlinie 2019: Behandlung der allergischen Rhinitis im deutschen Gesundheitssystem. In: Allergo Journal, Volume 28, pages 20-46, (2019). (Abrufdatum 07.10.25)
- Deutscher Allergie- und Asthmabund: Allergie (Abrufdatum 07.10.25)
- Yong, H., Di L. et al.: Efficacy and safety of combined loratadine and mometasone furoate therapy in allergic rhinitis patients (Abrufdatum 07.10.25)
- Gelbe Liste: Desloratadin (Abrufdatum 07.10.25)
- Gelbe Liste: Loratadin (Abrufdatum 07.10.25)
- Gelbe Liste: Cetirizin (Abrufdatum 07.10.25)
- Gelbe Liste: Levocetirizin (Abrufdatum 07.10.25)
Fachliche Endprüfung und Qualitätssicherung:
Sandra Winter, Gesundheitsredaktion
Sandra Winter ist eine erfahrene Gesundheitsjournalistin mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Ernährungswissenschaften, alternative Heilmethoden und Sportmedizin. Mit über 15 Jahren Erfahrung steht Sandra für vertrauenswürdige, wissenschaftlich fundierte und gut recherchierte Gesundheitsinformationen – immer am Puls aktueller Forschung und Trends in der Gesundheitsbranche. Mehr zu Sandra Winter